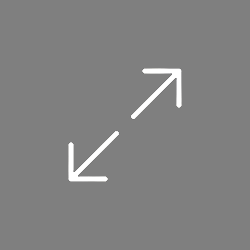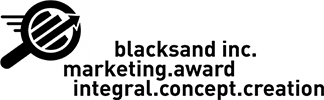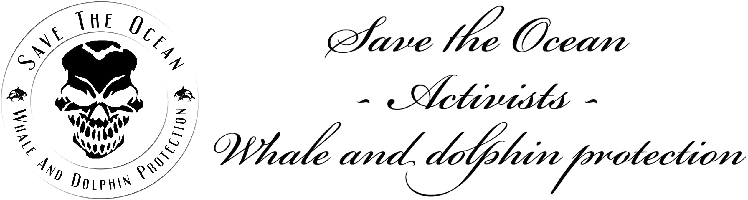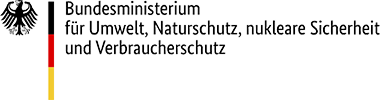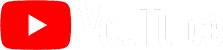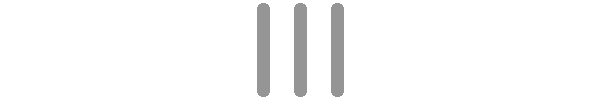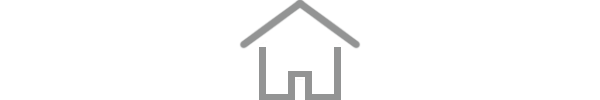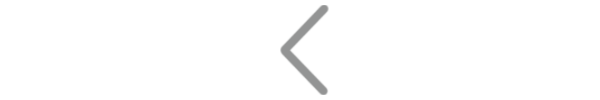»#Generation #Corona: Wie geht es unseren Kindern?«, »2 Jahre Ausnahmezustand«, Warnsignale und Ratschläge zu Pandemie Folgen
Dortmund, 8. April 2022
#Ängste, #Depressionen, #Einschlafstörungen: Ist es nur ein Bauchgefühl, dass die Beschwerden unserer Kinder in der Pandemie zugenommen haben? Wieviel Angst ist normal? Und wie kann man vorbeugen? Diese und weitere Fragen zu den Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche beantworteten Experten am Dienstag, 5. April 2022, in der Sprechstunde der KVWL in Dortmund.
Einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf aus dem vergangenen Herbst zufolge war jedes vierte Kind in der Pandemie psychisch auffällig. »Ich war teilnahmslos, mein einziges Ziel war es, durch den Tag zu kommen« – »Ich möchte nicht schuld daran sein, dass mein Freund erkrankt« – »Ich habe mich benachteiligt gefühlt« – diese und weitere Zitate machten Sorgen der jungen Generation an diesem Abend deutlich. Dr. med. Gudula Berger, Patientenberatung von Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) und KVWL in Münster, begrüßte 3 Experten in der Sprechstunde, an der Interessierte auch online teilnehmen konnten.
Michael Achenbach, Facharzt für #Kinder und Jugendmedizin aus Plettenberg, brachte das Frühjahr 2020 plastisch in Erinnerung: »Im Februar in den Schulen: volle Klassenzimmer, Anfeuerungsrufe aus der Turnhalle. Und dann im März 2020: Stille, Ruhe«, schilderte er. »Auf einmal brach Selbstverständliches weg«, ergänzte Dr. med. Undine Waßermann, Fachärztin für Kinder- und Jugend-Psychiatrie und -Psychotherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Schule und Kindergarten schlossen, Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte wurden eingeschränkt und viele Kinder waren in Sorge um besonders gefährdete Familienangehörige: »Was ist mit der Oma?« Auch waren die Eltern von jetzt auf gleich mehr zuhause – was Vor- und auch Nachteile hatte. Sozialpädagoge Oliver Staniszewski, Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeut in Witten, erklärte: »Wenn nicht einmal die Erwachsenen eine Vorstellung von der Pandemie haben, erzeugt das auch bei den Kindern und Jugendlichen Unsicherheit.«
Medienkonsum gestiegen
»Während des ersten Lockdowns hat der tägliche Medienkonsum um 59 Prozent zugenommen«, zitierte Undine Waßermann eine Studie und erläuterte: »Bei Kindern gilt: je mehr Medienzeit, desto ausgeprägter sind die psychischen Folgen.« Bei Jungen waren es vor allem mehr Videospiele, Mädchen nutzten öfter soziale Medien, teils bis in die Nacht hinein. Michael Achenbach: »Dadurch wurde der Tag-Nacht-Rhythmus deutlich gestört, weil die soziale Kontrolle durch die Schule wegfiel.« Am Anfang habe der Lockdown auch Feriencharakter gehabt, so der Experte. »Die Eltern waren da häufig hilflos: ‚Aber mein Kind braucht das Tablet doch auch für den Unterricht!‘« Sie hätten erst eine Strategie für eine ausgewogene Mediennutzung entwickeln müssen. »Online Freunde zu treffen war hingegen möglich, das war auch eine gute Kontaktmöglichkeit«, so Achenbach. »Manche haben im Lockdown fließend Englisch gelernt durch den Kontakt mit Spielern und Chat-Partnern in der ganzen Welt«, pflichtete Oliver Staniszewski ihm bei.
2 Jahre Ausnahmezustand
»Der erste Lockdown war für Einzelne auch eine Entlastung«, sagte Michael Achenbach. Denn für einige fiel mit der Schule zunächst ein Stressfaktor weg. Im zweiten, längeren Lockdown hingegen »konnte man den Lichtschein am Ende des Tunnels nicht so wahrnehmen« – ein interessanter Unterschied. Achenbach beschrieb den Wechsel aus Lockerungen und erneutem Lockdown mit Wechselunterricht in halber Klassenstärke. Und nach Delta waren seit dem Winter mit Omikron zunehmend Kinder und Jugendliche von Infektionen betroffen. »Zwei Jahre Kitas und Schulen im Ausnahmezustand. Was hat das mit den Kindern gemacht?«, fragte Achenbach. Dafür gebe es keine generelle Antwort. »Es gab auch viele Kinder, denen es damit gut ging. Generation Corona: Gibt es die überhaupt?« Er appellierte, lieber auf den Einzelfall zu schauen: »Nicht alles, was ich gesehen habe, war coronabedingter Stress, sondern ganz normaler.«
Konkret haben sich einer Studie zufolge 71 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der ersten Welle der Pandemie belastet gefühlt. Bei den Eltern waren es 75 Prozent, auch durch die für alle neue Form des Unterrichts: Zwei Drittel der Eltern hätten sich Unterstützung beim »Homeschooling« gewünscht. Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen verdoppelten sich während der Pandemie, so Undine Waßermann: »Psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen haben zugenommen. Und auch Essstörungen, weil durch den Lockdown oft die soziale Kontrolle über das Essverhalten gefehlt hat.«
Angst vor, mit und nach #Corona
Laut Michael Achenbach war es bei Kindern und Jugendlichen zum einen die Angst vor Corona, konkret vor der Impfung, vor der Erkrankung, vor dem Unbekannten. Die Angst mit Corona war dann: »Kann ich meine Oma, meinen Opa anstecken?« Und die Angst danach vor Long-Covid, vor Langzeitfolgen. Letztlich gelte aber: »Die Impfung ist das Angst mindernde Werkzeug. Damit kommen wir Schritt für Schritt raus aus der Cororona Pandemie.« Auch soziale Phobien, also die Unsicherheit im Umgang mit anderen, haben laut Oliver Staniszewski bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Der fehlende Umgang miteinander habe bei Jugendlichen für Ängste gesorgt, bei kleinen Kindern äußerte sich das eher zum Beispiel durch Bauchschmerzen. Auch für Undine Waßermann war Ängstlichkeit verstärkt feststellbar: »Angststörungen und Depressivität bis hin zu Suizid-Gedanken haben zugenommen«, so die Fachärztin. Einer Studie der Uni Essen zufolge habe es, so Michael Achenbach, bei Kindern und Jugendlichen vermehrt Suizidversuche nach einer Depression gegeben.
Soziales Gefälle
Sozial benachteiligte Kinder erlebten die Pandemie dabei besonders stark, wie Undine Waßermann erläuterte: »Weil ambulante Jugendhilfe Maßnahmen wegfielen, hat auch die Wächter-Funktion abgenommen. Auch der Zugang zu helfenden Einrichtungen war durch Corona erschwert.« Entsprechend habe die Kindswohlgefährdung laut statistischem Bundesamt 2020 zugenommen. »Welche Belastungen sind denn normal?«, fragte Oliver Staniszewski. »Die Klassenfahrt und den Abi-Ball gab es nicht, das lässt sich nicht wiederholen, nicht aufholen, das war leider für alle ‚normal‘. Und wo wird es pathologisch?«, fragte der Experte. »Kinder mit geringeren Ressourcen litten hier am meisten. Dinge, die schwierig sind, werden hier noch schwieriger«, meinte auch Staniszewski. Er erläuterte: »Im Einfamilienhaus mit großem Garten und Trampolin ging alles besser als in der Etagenwohnung, wo mehrere Kinder sich ein Zimmer und auch ein Tablet teilen.« Der Experte appellierte: »Wir brauchen bessere Hilfesysteme für Familien, wo die Ressourcen knapp sind.« Kinder hätten eine große Anpassungsleistung erbracht in den vergangenen Jahren. »Sie brauchen jetzt Unterstützung, auch an den Schulen, um das soziale Miteinander zu fördern, um das Gefühl, sich auf Distanz halten zu müssen, zu verarbeiten.«
Undine Waßermann ermunterte, bestehende Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ihre Klinik in Herdecke beispielsweise biete ein breites Behandlungsspektrum ambulanter und stationärer Hilfen inklusive Tagesklinik – abhängig davon, wie akut eine Krise ist. Waßermann schilderte die Erschwernisse bei der Behandlung junger Patientinnen und Patienten: »Allein durch das Maske tragen fehlt viel an Kommunikation, um einschätzen zu können, wie es dem jungen Menschen geht, das macht das Arbeiten deutlich schwerer.« Medien seien dabei aber hilfreich gewesen, zum Beispiel in der Videosprechstunde, die eine weitere Begleitung überhaupt erst ermöglichte.
Warnsignale
Gab es bei den Warnsignalen Unterschiede zwischen den Geschlechtern? »Wütende Jungs haben eher den Trick für sich gefunden, einen Stuhl zu werfen und so Aufmerksamkeit zu erzeugen«, beschrieb Undine Waßermann eine Form der psychischen Stressreaktion. »Mädchen dagegen reagieren eher traurig, sind teilnahmslos, da fällt eine seelische Störung schwerer auf.« Die Frage sei hier stets: »Wen brauchen wir noch im Boot: den Schulpsychologen? Die Integrationshelferin? Die Wohngruppenleitung? Den öffentlichen Gesundheitsdienst?« Wichtig sei es auch Sport zu ermöglichen: »Dadurch kann ich mich als Jugendlicher vergleichen, erhalte ein soziales Feedback, das gibt Struktur und Verbindlichkeit«, bekräftigte Waßermann.
»3C plus P«
Michael Achenbach erlebte junge Patienten mit extrem starker Gewichtszunahme während Corona: »Der Sport ging runter auf null, die Ernährung aber blieb gleich«, so der Facharzt. In Anlehnung an 3G hieß es oft »3C: Computer, Cola, Chips – manchmal 3C plus P wie Pizza«. Entsprechend gebe es immer mehr Diabetes Typ1 und sogar Typ2 unter den Kindern. Ob manche Schädigungen dieser und anderer Art durch die Maßnahmen entstanden sind? Es gebe zumindest starke Hinweise darauf. Wobei Achenbach relativierte: »Ärzte und Therapeuten sehen eher die negativen Umstände, weil nicht die Gesunden zu uns kommen, sondern die Kranken.«
Was hilft, mit dieser Situation besser zurechtzukommen? Ein guter familiärer Hintergrund: Ein intaktes Familienleben sorge für eine gute Widerstandskraft und helfe Kindern gut durch die Pandemie zu kommen, durch das Bewältigen der neuen Umstände teilweise sogar an ihr zu wachsen, so Michael Achenbach. Oliver Staniszewski meinte: »Kreatives hilft beim Bewältigen: Singen, Musizieren und andere kreative Tätigkeiten. Und in jedem Fall: Geduld mitbringen.« Achenbach weiter: »Die ganz Kleinen, die Ein- bis Zweijährigen, haben in der Pandemie mehrheitlich profitiert, wenn die Eltern entsprechend Zeit hatten. Für Jugendliche hingegen war es durch Corona oft erheblich schwerer, sich in Richtung Selbstständigkeit zu entwickeln, hin zu einer autonomen Person: »Alleine in die Schule gehen, in den Sportverein, zu Freunden.« Das helfe beim Erreichen der Autonomie.
Vorsorgeuntersuchungen nachholen
Um Probleme und Veränderungen frühzeitig zu entdecken, sei es jetzt bei Kindern besonders wichtig, die versäumten Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, so Michael Achenbach. Und bei Jugendlichen, die oft nicht mehr zum Kinderarzt gehen wollen und noch keinen Hausarzt haben? Das sei schon eine Herausforderung, diesen Übergang zu organisieren. Achenbachs Tipp für Eltern: »Jugendliche möchten erwachsener behandelt werden. Damit sie bei diesem Thema nicht die Augen verdrehen, hilft es weniger Besorgnis zu äußern und mehr über Fakten zu überzeugen, dass eine frühzeitige Diagnostik wichtig ist.«
»Ich habe mir vieles selbst erarbeitet und viel dabei gelernt« – »man lernt, Zeit mit der Familie mehr Wert zu schätzen« – auch positive Zitate der Jugend waren in der Sprechstunde zu hören. Ein Fazit: Nicht jede psychische Auffälligkeit wird zur Erkrankung, es ist aber wichtig, sie frühzeitig zu untersuchen. Und nicht jede altersbedingte Andersartigkeit ist damit gleichzusetzen. »Die Jugend war schon immer anders«, hieß es am Schluss der Sprechstunde. Das hätten schon die Sumerer um 3.000 vor Christus gewusst und auf einer Tontafel festgehalten: »Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, sie zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend übernommenen Werten gegenüber«.
Information
Bei der Vermittlung eines Termins bei einem Psychotherapeuten in der Umgebung hilft die Terminservicestelle der KVWL unter Telefon +49116117 . Zur Arztsuche inklusive Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten
. Zur Arztsuche inklusive Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten .
.
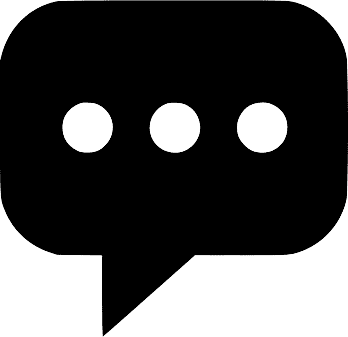
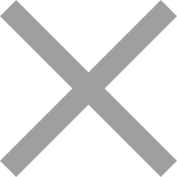

























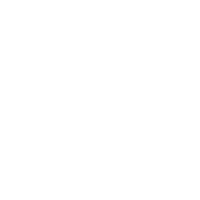
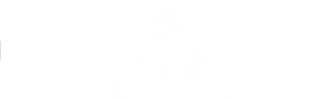









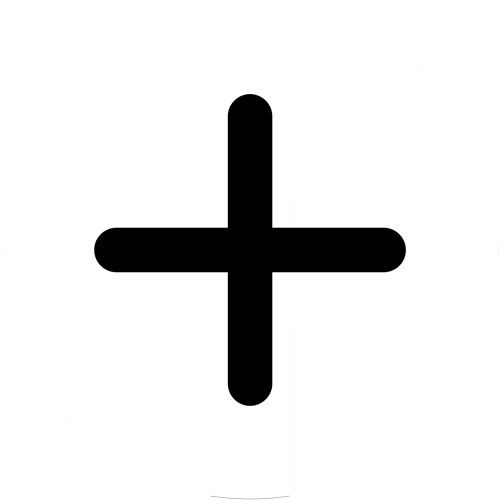
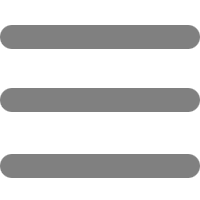

 Gütsel RSS Feed
Gütsel RSS Feed